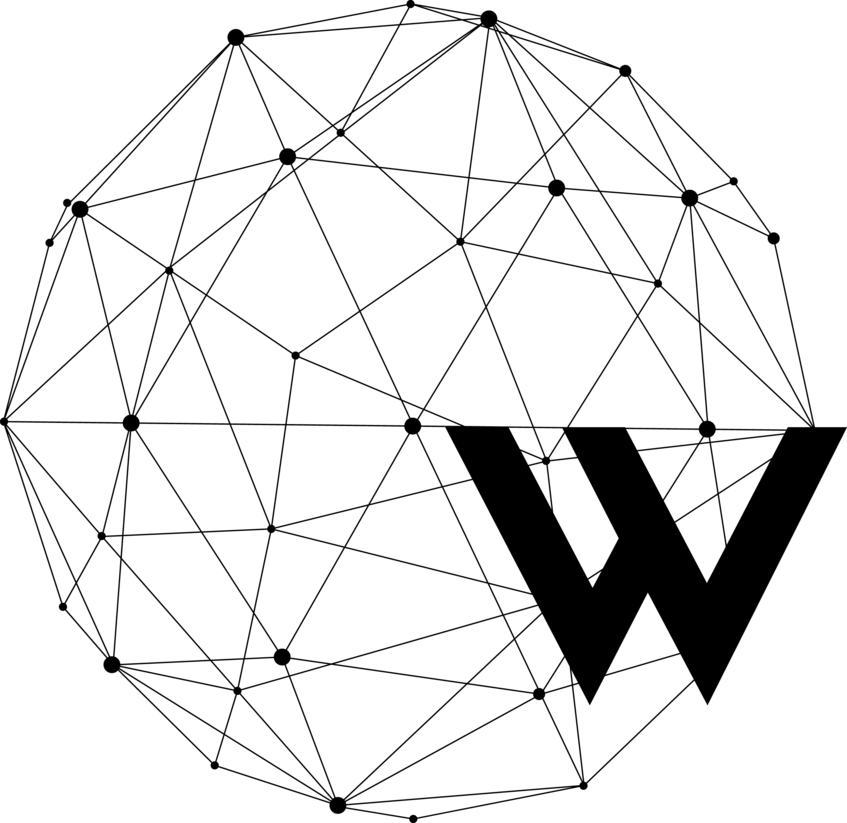Ring-Vorlesung: Künstliche Intelligenz: Spannungsfelder, Herausforderungen und Chancen (2024S)
In Kooperation zwischen dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien sowie der Stadt Wien eröffnet die diesjährige Ringvorlesung unterschiedliche Perspektiven zum Thema „Künstliche Intelligenz“ aus Theorie und Praxis. Als externer Kooperationspartner der diesjährigen Ringvorlesung tritt außerdem der Verein „Women in AI“ auf. Expertinnen und Experten beleuchten etwa verschiedene KI-Strategien in Europa, China und den USA, den Einfluss von Entwicklungen im Bereich der KI auf unsere Arbeits- und Bildungswelt oder ethische Fragen, die der Technologieentwicklung zugrunde liegen. Wir fragen außerdem, welchen Weg der Digitalisierung die Stadt Wien hier einschlägt und wie wir, nicht zuletzt, Einfluss darauf nehmen können, eine gerechte Zukunft im Zeitalter der KI zu gestalten. Untenstehend finden Sie ein ausführliches Programm unserer Einheiten.
Programm
| # | Einheit |
|---|---|
| 1 Donnerstag, 7. März 2024, 16:30-19:00 | Auftakt Rathaus Eröffnung: Moderation Antonia Titze, Begrüßungsworte Stadträtin Kaup-Hasler, Rektor Sebastian Schütze, Dekanin Christina Lutter Diskussion: Oliver Rathkolb (Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien), Wolfgang Müller (MD Stv., Stadt Wien), Mark Coeckelbergh (Philtech, Universität Wien), Julia Eisner (Verein „Women in AI“) Stichworte und Fragen:
|
| 2 Donnerstag, 14. März 2024, 16:45-18:15 | Thema: KI in China Speaker: Timo Daum (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) + Christian Göbel (Sinologie, Universität Wien)
|
| 3 Donnerstag, 21. März 2024, 16:45-18:15 | Thema: The AI-Dilemma – Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz Dokumentation: The AI-Dilemma (Center for Humane Technology)
|
| 4 Donnerstag, 11. April 2024, 16:45-18:15 | Thema: KI in Europa Speaker:innen: Nikolaus Forgó (Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht, Universität Wien) + Florian Schmidt (APA-Faktencheck)
|
| 5 Donnerstag, 18. April 2024, 16:45-18:15 | Thema: Demokratiepolitik und KI Speaker: Harald Katzmair (FAS-Research) + Oliver Rathkolb (Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)
|
| 6 Donnerstag, 25. April 2024, 16:45-18:15 | Thema: Digitaler Humanismus Speaker:innen: Sandra Heissenberger, Tanja Sinozic-Martinez ( beide Stadt Wien) + Walter Palmetshofer ( TU Wien)
|
| 7 Donnerstag, 2. Mai 2024, 16:45-18:15 | Thema: KI im Bildungsbereich und der Hochschullehre Speaker:innen: Petra Herczeg (SPL PuKW, Mitverfasserin der KI-Guidelines der Uni Wien) + Roland Steinacher (Leiter DLE Studienservice und Lehrwesen, Mitverfasserin der KI-Guidelines der Uni Wien)
|
| 8 Donnerstag, 16. Mai 2024, 16:45-18:15 | Thema: Information und Desinformation Speaker: Jan Rau (Hand-Bredow-Institut, Internetforscher, rechte Meinungen im Netz) + Ahrabi Kathirgamalingam (Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Rassismus- und Medienforschung)
|
| 9 Donnerstag, 23. Mai 2024, 16:45-18:15 | Thema: Women in AI
Speaker:innen, Verein Women in AI: Natalie Ségur-Cabanac (Data Protection), Mira Reisinger (Data Scientist) und Eugenia Stamboliev (AI ethics & critical studies)
|
| 10 Donnerstag, 6. Juni 2024, 16:45-18:15 | Thema: Arbeit im Zeitalter der KI Speaker:innen: Hakon Runer (KI in Unternehmen) + Sabine T. Köszegi (Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien und Vorsitzende des Fachbeirates „Ethik der Künstlichen Intelligenz an der Österreichischen UNESCO-Kommission“)
|
| 11 Donnerstag, 13. Juni 2024, 16:45-18:15 | Thema: KI in der Kunst (tbc) Speaker:innen: Gerfried Stocker (ARS Electronica) (tbc) + Gast (tbc)
|
12 | Thema: Wissensbasierte Entrepreneurship Speaker:innen: Markus Peschl (Kognitionswissenschaften und Philosophie, Universität Wien) + Start-Up: Attune, Zoya Dare und Laura M. Sartori
|
| 13 Donnerstag, 27. Juni 2024, 16:45-18:15 | Thema: KI in der Medizin Speaker:innen: Christoph Bock (MedUni Wien) + Christiane Druml (MedUni Wien)
|
Allgmeine Informationen
- Die Vorlesung findet Donnerstags, von 16:45-18:15 im BIG-Hörsaal der Universität Wien statt
- Alle Einheiten werden live gestreamt und sind auf YouTube auch zum Nachschauen verfügbar.
- Die Vorlesung findet in Kooperation zwischen dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien, der Stadt Wien und dem Verein Women in AI statt.
- Konzeption und Organisation: Oliver Rathkolb und Maximilian Brockhaus